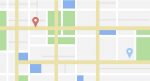8. Februar 2021 – von Philipp Bagus und Thorsten Polleit Was sagt Hayeks Liberalismus dazu? Philipp Bagus Am 5. Februar 2021 hat der Ökonom Arash Molavi Vasséi den Aufsatz „Hayek und die Pandemie“ in der F.A.Z. veröffentlicht. Er will darin aufzeigen, wie seiner Meinung nach Friedrich August von Hayek (1899–1992) die Politiken, zu denen die Staaten in der Coronavirus-Pandemie greifen, vor dem Hintergrund „liberaler Prinzipien“ beurteilen würde. Nach Lektüre des Aufsatzes kommt man zum Schluss: Der freie Markt, der Liberalismus, kann nicht die Lösung sein, vielmehr muss der Staat es richten, und darin ist sich Hayek einig mit den Neo-Keynesianern; und dort, wo Hayek Bedenken anmeldet – bei der Geldpolitik, die die elektronische Notenpresse anwirft und Null- und
Topics:
Thorsten Polleit considers the following as important: 6b.) Mises DE, Aktuelles, Featured, Geld, newsletter, Politik, Rubriken, Staat, Wirtschaft
This could be interesting, too:
Nachrichten Ticker - www.finanzen.ch writes Die Performance der Kryptowährungen in KW 9: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Nachrichten Ticker - www.finanzen.ch writes Wer verbirgt sich hinter der Ethereum-Technologie?
Martin Hartmann writes Eine Analyse nach den Lehren von Milton Friedman
Marc Chandler writes March 2025 Monthly
8. Februar 2021 – von Philipp Bagus und Thorsten Polleit
Was sagt Hayeks Liberalismus dazu?

Philipp Bagus
Am 5. Februar 2021 hat der Ökonom Arash Molavi Vasséi den Aufsatz „Hayek und die Pandemie“ in der F.A.Z. veröffentlicht. Er will darin aufzeigen, wie seiner Meinung nach Friedrich August von Hayek (1899–1992) die Politiken, zu denen die Staaten in der Coronavirus-Pandemie greifen, vor dem Hintergrund „liberaler Prinzipien“ beurteilen würde. Nach Lektüre des Aufsatzes kommt man zum Schluss: Der freie Markt, der Liberalismus, kann nicht die Lösung sein, vielmehr muss der Staat es richten, und darin ist sich Hayek einig mit den Neo-Keynesianern; und dort, wo Hayek Bedenken anmeldet – bei der Geldpolitik, die die elektronische Notenpresse anwirft und Null- und Negativzinsen setzt –, da liegt er falsch, hier haben nur die Neo-Keynesianer recht.
Lässt sich Hayeks Liberalismus in dieser Weise dienstbar machen, um dem immer unverhohleneren staatlichen Interventionismus, wie ihn der Neo-Keynesianismus fordert, eine (schein-)liberale Legitimierung an die Hand zu geben? Um diese Frage beantworten zu können, müsste man zunächst Hayeks liberale Prinzipien kennen. Doch davon ist im Text nichts zu lesen. Wie steht Hayek zum Eigentum, zur Freiheit des Individuums, zur Frage der Gleichheit, welche Beziehung besteht zwischen diesen Konzepten und Hayeks Staatsverständnis? Weil der Autor seine Leser darüber im Dunkeln lässt, können sie gar nicht nachvollziehen, ob das, was der Autor als Hayeks Position interpretiert, tatsächlich auch Hayeks wäre.

Thorsten Polleit
Wenn der Autor schlussfolgert, dass Hayek dieser oder jener Politik zustimmen würde: Kann der Leser daraus ableiten, dass sich die Liberalen verbeugen sollten vor dem Staat und seinem Tun, dass ihre Kritik unangebracht ist und verstummen sollte? Die Antwort lautet nein. Allein deswegen nicht, weil Hayeks Liberalismusverständnis – seine Idee von Freiheit, Gerechtigkeit, der Rolle des Staates –bei manchen liberalen und vielen libertären Denkern nicht unwidersprochen geblieben ist; dass Hayek, auch wenn er weithin als der „große Liberale“ verehrt wird, nicht als „das Maß aller Dinge“ gesehen wird; beispielsweise nennt Hans-Herman Hoppe (* 1949) Hayek einen „Radikalliberalen, der sich als Sozialdemokrat entpuppt.“
Im Folgenden wollen wir nicht in die Diskussion einsteigen, welche Politik Hayek denn in der aktuellen Krise gutheißen würde und welche nicht. Wir wollen uns vielmehr mit den Argumenten des Autors auseinandersetzen (die er Hayeks Position denkt entliehen zu haben), mit denen er meint, am Ende seiner Darstellung – Hokus Pokus Fidibus – den Neo-Keynesianismus als den überlegenen Gewinner ausrufen zu können – vermutlich zur Freude aller, die im Staat (wie wir ihn heute kennen) den Heilsbringer erblicken, und die den staatlich verordneten Freiheitsentzug, das Heruntermanipulieren der Zinsen durch die Zentralbanken und das willkürliche Ausweiten der Geldmenge per Kreditvergabe in einer Pandemie befürworten.
Es gibt keine „öffentliche Gesundheit“
Der Autor beginnt seinen Aufsatz mit der Feststellung, man müsse in einer Epidemie zwischen dem Gut der „öffentlichen Gesundheit“ und individueller Freiheit abwägen. Jedoch ist die Existenz einer „öffentlichen Gesundheit“ eine holistische Illusion. Gesundheit ist immer individuell. Da ist die Gesundheit eines Coronagefährdeten; aber da ist auch die Gesundheit des durch den Lockdown dem Alkohol verfallenen Unternehmers, die Gesundheit des an Depressionen leidenden Lockdown-Geschädigten, die Gesundheit des stundenlang Maske tragenden Kindes, die Gesundheit des Krebserkrankten, dessen Tumor wegen Lockdowns später erkannt wird, oder die Gesundheit eines Menschen, dessen Lebenserwartung sich durch die Lockdown-bedingte Absenkung des Lebensstandards um ein paar Monate reduziert hat. Derzeit schränkt die Regierung unter dem Vorwand, einen Teil der Bevölkerung (Risikogruppen) gesundheitlich schützen zu wollen, die individuelle Freiheit der Gesamtbevölkerung stark ein, was wiederum andere Bevölkerungsteile gesundheitlich schädigt.
Externalitäten sind hier kein Argument
Im Mittelpunkt von Vasséis‘ Verteidigung der Staatseingriffe in einer Epidemie stehen die sogenannten externen Effekte, die er als unkompensierte Auswirkungen auf Unbeteiligte definiert. Negative Externalitäten seien Auswirkungen von Entscheidungen zum Nachteil unbeteiligter Dritter. Im Gegensatz dazu seien positive Externalitäten Auswirkungen von Entscheidungen zum Vorteil unbeteiligter Dritter. Vasséi argumentiert wie folgt: In einer Epidemie könnte sich eine immunstarke Person, die sich dazu entscheidet, soziale Nähe zu pflegen, mit einem Virus anstecken und dadurch negative Externalitäten auf gefährdete Unbeteiligte zeitigen, weil diese sich in der Folge auch anstecken könnten („Ansteckungsketten“).
Derartige Wirkungsketten können tatsächlich bestehen, nur ist nicht klar, warum diese einen Staatseingriff begründen sollten. Jede Entscheidung des Einzelnen in der Gesellschaft kann negative unkompensierte Auswirkungen auf Unbeteiligte zeitigen. Nimmt eine Person beispielsweise am Autoverkehr teil, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls für Dritte. Das Ganze lässt sich auch noch fröhlich weiterspinnen. Denn der erste Unfall kann zu Auffahrunfällen führen – also weitere Unbeteiligte in einer Art Ansteckungskette treffen. Nicht zu vergessen sind weitere Auswirkungen wie Depressionen bei Angehörigen der Unfallopfer, die noch unbeteiligter an der ursprünglichen Entscheidung sind, und so weiter. Diese unkompensierten Auswirkungen sind nicht abzustreiten, dennoch würde wohl niemand behaupten, der Staat müsse das Autofahren verbieten, weil derartige schwerwiegende negativen Externalitäten möglich sind.
Ein weiteres Beispiel einer negativen Externalität ist gerade ein Lockdown. Wenn die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten die Entscheidung trifft, in Deutschland Geschäfte und Schulen zu schließen, so hat das negative Auswirkungen auf Millionen Deutsche, die an dieser Entscheidung nicht beteiligt waren. Ein Leben in der arbeitsteiligen Gesellschaft birgt Risiken. Jedoch profitieren auch alle Mitglieder der Gesellschaft von Arbeitsteilung und Preissystem. Kaufe ich ein Brötchen in einer Bäckerei, so gibt es als Folge einen Brötchenpreis. Dieser Preis dient dann anderen Marktteilnehmern als Informationsquelle; wie beispielsweise einem Restaurantbesitzer, der Brötchen für seinen Betrieb kaufen möchte. Dritte können ihre Handlungen dank dieses Preises besser planen. Ein Tauschgeschäft ist damit nicht nur Grundlage einer arbeitsteiligen Gesellschaft, sondern zeitigt auch positive Externalitäten. Ein Lockdown beschränkt die möglichen Tauschgeschäfte und damit auch die positiven Externalitäten.
Wenn durch ein Tauschgeschäft, wie es bei einem Restaurantbesuch stattfindet, das Ansteckungsrisiko steigt, kann dies als negative Externalität interpretiert werden. Jedoch impliziert das Verbot dieses Tauschgeschäfts gleichzeitig eine negative Auswirkung auf Unbeteiligte, die etwa durch den allgemeinen fallenden Lebensstandard oder fehlende Preisinformationen geschädigt werden. Der staatlich erzwungene Wegfall der positiven Externalität des Tauschs kann also als eine negative Externalität betrachtet werden. Kurzum, das ganze Konzept der negativen Externalitäten, wie sie der Autor definiert, taugt nicht, um irgendeine politische Folgerung daraus herzuleiten.
In einer freien Marktwirtschaft entscheidet jeder Marktteilnehmer selbst, wieviel Risiko er auf sich nimmt, um die Vorteile des gesellschaftlichen Miteinanders genießen zu können. Er entscheidet, ob er am Straßenverkehr teilnimmt, und wenn ja, welche Sicherheitsstandards er in sein Auto einbaut. Er wägt die Vorteile des Autofahrens gegen Nachteile und Risiken ab. Genauso wägt jeder Mensch Vorteile und Nachteile der sozialen Interaktion. Soziale Nähe mag erquicken und Stress abbauen, kann aber auch Gram ob eines Streites verursachen, zu verletzten Gefühlen führen oder auch zur Ansteckung mit einer Krankheit. In einer freien Marktwirtschaft kann jeder frei entscheiden, ob für ihn die Vorteile des Sozialen überwiegen, oder er sich isolieren möchte.
Ohne soziale Interaktion, ohne Tausch, gibt es jedoch keine Gesellschaft, nur isolierte Individuen. Durch die arbeitsteilige Gesellschaft und ihre Tauschkontakte entsteht gerade erst die Gesellschaft und erzeugt positive Externalitäten in Form eines ungeheuer höheren Lebensstandards.
Das Trittbrettfahrerproblem, das keines ist
Nachdem schon die negativen Externalitäten als Beweis für die Staatsnotwendigkeit in der Epidemie herhalten mussten, führt der Autor dann kurioserweise auch noch positive Externalitäten für den gleichen Zweck ins Feld. Der Autor argumentiert, dass das Maskentragen positive Externalitäten für Unbeteiligte bedeute, da die Maske Dritte schütze. Jedoch entstünde im freien Markt ein Trittbrettfahrerproblem nach dem Motto: Sollen die anderen doch Masken tragen, dadurch werde ich geschützt; selbst trage ich aber keine Maske, das ist mir zu lästig. Letztlich würden dann nicht genug Menschen eine Maske tragen. Daher müsse der Staat eingreifen und die Menschen zur Kooperation, das heißt dem Maskentragen, zwingen.
Letzten Endes bedeutet dieses Argument einen Rückfall in den vorwissenschaftlichen Objektivismus, den die Ökonomik mit der subjektiven Wertlehre eigentlich schon lange überwunden hat. Der Autor behauptet, dass das Maskentragen objektiv positive Externalitäten zeitigen würde. Empfinden ist indes subjektiv, und wenn wir andere Menschen mit Masken sehen, dann können wir sehr wohl darunter psychisch leiden. Zum einen steigt erwiesenermaßen der Stresslevel, wenn man sein Gegenüber nicht mehr lächeln sieht. Zum anderen kann der Anblick der Masken bei einem Coronaskeptiker auch Unmut darüber erzeugen, dass seine Mitmenschen sich ein solches Unterwerfungssymbol ins Gesicht hängen. Ganz zu schweigen davon, dass das lange Maskentragen das Immunsystem schwächt und damit Infektionen wahrscheinlicher macht, die wiederum negative Externalitäten durch Ansteckung Dritter erzeugen können.
Es stellt sich auch die Frage, warum der Autor das Maskentragen als „Kooperation“ darstellt. Der Coronaskeptiker würde umgekehrt argumentieren, dass die Menschen doch bitte beim zivilen Ungehorsam kooperieren mögen: Niemand solle eine Maske tragen, und die Menschen sollten die staatlichen Restriktionen ignorieren. Beteilige sich eine kritische Masse beim zivilen Ungehorsam, könne die Polizei die staatlichen Freiheitsbeschränkungen nicht durchsetzen mit positiven Externalitäten für alle. Der Coronaskeptiker wird sich mithin auch einem umgekehrten Trittbrettfahrerproblem ausgesetzt sehen. Denn allzu leicht könnte er denken: Sollen doch die anderen sich der Maske in zivilem Ungehorsam verweigern. Dadurch wird die Polizei eventuell überfordert, ich selbst trage aber Maske, damit ich mir keinen Ärger einhandele. Denken zu viele Menschen auf diese Weise, wird die kritische Masse von Maskenverweigerern verfehlt.
Der Staat ist keine Versicherung
Im Weiteren feiert der Autor den Staat dafür, dass dieser als Versicherer letzter Instanz fungiere und in einer Epidemie die gesellschaftlichen Wohlfahrtsverluste temporär deckeln könne. Dem ist folgendes zu erwidern. Erstens können selbstverständlich auch private Versicherungen Verluste aus Epidemien versichern und tragen. Als Beispiel einer solchen Absicherung ist das Tennistunier von Wimbledon zu nennen, dessen Veranstalter nach der Tunierabsage im letzten Jahr von seiner Versicherung entschädigt wurde.
Zweitens deckelt der Staat die gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverluste nicht, sondern verteilt lediglich um. Seine Zielsetzung ist, von jenen zu nehmen, die durch die Coronakrise weniger verloren haben, und jenen zu geben, die stärker von der Epidemie betroffen sind. Jedoch macht diese Umverteilung die Gesellschaft insgesamt nicht reicher, das heißt der gesamtwirtschaftliche Wohlfahrtsverlust wird nicht geringer oder gedeckelt.
Drittens erhöht der Staat durch die Lockdown-Maßnahmen und Freiheitsrestriktionen die gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverluste, indem er Millionen von Existenzen ruiniert und große Bevölkerungskreise gesundheitlich und psychisch schädigt. Hier von einem Versicherer letzter Instanz zu sprechen, macht wenig Sinn. Denn ein Versicherer zerstört ja nicht Eigentum und Lebensgrundlage seiner Versicherten.
Vasséis Argumente können nicht überzeugen
Kurioserweise preist der Autor Hayeks Theorie des Marktprozesses als Entdeckungsverfahren, ohne zu erkennen, dass er sich durch sein gleichzeitiges Lob des staatlichen Dirigismus in der Coronakrise in einen Widerspruch verzettelt. Zwar produziert der Staat nicht selbst den Impfstoff (Gott sei Dank), jedoch bestimmt er zentral, auf welche Art und Weise die Menschen mit der Krise umzugehen haben, in dem er pauschale Unternehmensschließungen, Versammlungsverbote, Bewegungsradien und Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht durchsetzt.
Durch seinen zentralistischen Ansatz lässt der Staat gerade nicht die marktgetriebenen Experimente zu, die neues Wissen hinsichtlich der besten Antworten auf die Coronaherausforderungen liefern. In einer freien Gesellschaft könnten etwa Unternehmen eigene Hygienekonzepte ausprobieren und auf die Wünsche ihrer Kunden reagieren. Ein allgemeiner Lockdown und Maskenpflicht verhindern gerade, dass andere Wege erprobt werden und so neues Wissen entdeckt wird.
Insgesamt scheitert der Versuch, den Staat als Retter in der Coronakrise darzustellen, auf der ganzen Linie. Gerade das Gegenteil ist der Fall, denn der Staat schädigt durch seine Übergriffe die Gesundheit und den Wohlstand von Millionen von Menschen. Das Externalitätenargument ist hier unbrauchbar. Jede Handlung kann sowohl negative als auch positive Externalitäten zur Folge haben, die darüber hinaus noch subjektiver Natur sind. Aus dieser Tatsache lässt sich eine Legimitation von Staatseingriffen schlicht und einfach nicht herleiten. Durch die zentralistische Planung des Staates wird zudem die notwendige Schaffung von Wissen behindert. Der Staat wird in einer freien Marktwirtschaft als Versicherer oder Impfstoffnachfrager nicht benötigt. Wie bei allen Gütern und Dienstleistungen erfolgt die Bereitstellung effizienter im Markt.
Keine Widerlegung der Theorie
Der Autor gibt weiterhin vor, Hayeks „Achillesferse“ offenzulegen, und damit meint er die Österreichische Konjunkturtheorie. Denn „[d]ieser Ansatz, besonders in seiner modernisierten Form, steht auf tönernen Füßen: Er basiert vor allem auf einer in der Theoriegeschichte einmalig schlecht begründeten Zinstheorie, die auf Ludwig von Mises zurückgeht.“ Der Kritikpunkt ist dabei also die Zinstheorie, wie sie Hayeks akademischer Lehrer Ludwig von Mises (1881–1973) formuliert hat.
Der Leser erfährt allerdings nicht, was an Mises‘ Zinstheorie zu beanstanden wäre. Und er wird auch nicht darüber informiert, welche Zinstheorie denn die bessere, die richtigere ist. Man könnte den Eindruck haben, dem Autor geht es hier um die Diffamierung einer Theorie, nicht um die inhaltliche Auseinandersetzung mit ihr. Wir halten es daher für angemessen, die Erklärung des Zinses, des „Urzinses“, wie Mises ihn formuliert hat, hier in aller Kürze aufzeigen.
Mises erklärt das Zinsphänomen im Kern erkenntnistheoretisch. Der Zins ist eine Kategorie des menschlichen Handels: ein Grundbegriff des Denkens, den man nicht verneinen kann, ohne seine Gültigkeit bereits vorauszusetzen. Dass der Mensch handelt, ist unbestreitbar wahr. Wer sagt „Der Mensch handelt nicht“, der handelt und widerspricht damit dem Gesagten.
Aus dieser unbestreitbaren Erkenntnis lässt sich weiterhin einsehen, dass Handeln stets zielgerichtet ist und den Einsatz von Mitteln erfordert, und dass Mittel knapp sind (wären sie nicht knapp, wären sie keine Mittel). Zeit ist ein unverzichtbares Mittel des menschlichen Handelns; zeitloses Handeln lässt sich nicht widerspruchsfrei denken.
Weil Zeit knapp ist, zieht der Handelnde das Früher dem Später vor. Darin kommt die Zeitpräferenz zum Ausdruck, und ihre Manifestation ist der sogenannte „Urzins“. Der Urzins steht für den Wertabschlag, den die spätere Erfüllung der Bedürfnisse gegenüber der früheren Erfüllung der Bedürfnisse – von gleicher Art und Güte und unter gleichen Bedingungen – erleidet.
Zeitpräferenz und Urzins stecken gewissermaßen in jedem Handelnden. Du und ich, wir alle haben stets und überall eine positive Zeitpräferenz und folglich auch einen positiven Urzins. Zeitpräferenz und Urzins können nicht verschwinden, sie können vor allem nicht null oder negativ werden.
Eine Geldpolitik, die den Marktzins unter den Urzins drückt, bewirkt Wirtschaftsstörungen – und dass das derzeit im Euroraum geschieht, ist offenkundig. An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Idee eines Null- oder Negativzinses unvereinbar ist mit dem System der freien Marktwirtschaft. Ohne positiven Zins ist keine arbeitsteilige, moderne Wirtschaft möglich – weil der Urzins der Handelnden immer und überall positiv ist. So gesehen liefe eine (dauerhafte) Null- und Negativzinspolitik auf die Abschaffung des kapitalistischen Systems (oder dem, was von ihm noch übrig ist) hinaus.
Ein falsches Inflationsverständnis
„Inflation meint hingegen einen allgemeinen Kaufkraftverlust des Geldes … . Vermögenspreisinflation ist keine Inflation!“, so ist weiterhin zu lesen. Das kann aber nicht richtig sein: Wenn Inflation „einen allgemeinen Kaufkraftverlust des Geldes“ bezeichnet, dann muss auch eine Vermögenspreisinflation ein „allgemeiner Kaufkraftverlust“ des Geldes sein. Jeder weiß doch: Wenn die Häuserpreise und Aktienkurse steigen, bekomme ich weniger Haus und Aktie für mein Geld, die Kaufkraft des Geldes nimmt ab.
Hilfreich wäre es gewesen, die Definition, die unter den Ökonomen der Österreichischen Schule akzeptiert ist, zu erwähnen: Inflation ist der Anstieg der Geldmenge. Steigende Konsumgüter- und/oder Vermögenspreise sind lediglich ein mögliches Symptom einer steigenden Geldmenge. In jedem Falle kommt es bei einer Vermehrung der Geldmenge zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen, egal ob dabei die Güterpreise steigen, unverändert bleiben oder fallen.
Weiter ist zu lesen: „Zinsbedingt steigende Vermögenspreise sind eine Änderung relativer Preise: Künftige Konsummöglichkeiten werden im Vergleich zum Gegenwartskonsum höher bewertet.“ Der zweite Teil des Satzes ist nicht richtig. Drückt die Zentralbank den Zins herunter, dann bedeutet das, dass die Menschen angeregt werden, den Gegenwartskonsum noch höher zu bewerten als den Zukunftskonsum. Konsum steigt zu Lasten der Ersparnis, die Zukunft wird sprichwörtlich abgewertet gegenüber der Gegenwart.
Die Politik des künstlich gedrückten Zinses verursacht viele Fehlentwicklungen, die man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte. Das Wirtschaften auf Pump wird ermutigt. Überkonsum und die Fehlallokationen, beides Folgen der Zinsmanipulation, sorgen für eine verstärkte Nutzung von Naturressourcen. Umweltprobleme werden so verschärft. Wenn man nicht alle Folgen der Zinsmanipulation richtig interpretiert und berücksichtigt, wird auch nicht das ganze Ausmaß des Schadens deutlich, der dadurch angerichtet wird.
Krisen als Folge des Interventionismus
Der Autor lobt, dass die Zentralbanken sich „keynesianisch“ verhielten, sich vor allem in Zeiten der Pandemie nicht an den Empfehlungen der Österreichischen Schule orientierten: „Folgten Zentralbanken den geldpolitischen Handlungsanweisungen dieser Theorie bei einer Pandemie, führte dies wohl zu schwerer Rezession und Massenarbeitslosigkeit.“ Diese Aussage kommt uns in erster Linie als ein Versuch vor, dem ungedeckten Papiergeld, dem Geldmonopol der Zentralbanken, Unbedenklichkeit zu attestieren, dem Neo-Keynesianismus das Wort zu reden.
Die monetäre Konjunkturtheorie der Österreichischen Schule ist – und das erwähnt der Autor leider nicht – keine herbeifabulierte Theorie. Sie ist mit logischen Mitteln, auf apriorischem Wege, hergeleitet und besagt im Kern, dass die Ausgabe von ungedecktem Geld durch Bankkreditvergabe notwendigerweise zu Boom und Bust führt. Das viele diese Einsicht nicht teilen, ist nicht verwunderlich, tritt doch mit ihr eine unangenehme Wahrheit zutage:
Es sind die Zentralbanken mit ihrem ungedeckten Geld und ihren Zinsmanipulationen, die für wiederkehrende und immer schlimmer werdende Wirtschafts- und Finanzkrisen sorgen. Zentralbanken sind so gesehen wie die Brandstifter, die als erste am Flammeninferno erscheinen und sich als „Retter“ gebärden. Wenn sie mit noch mehr Kredit und Geld und noch tieferen Zinsen die Krise „bekämpfen“, legen sie dadurch die Saat für eine künftig noch größere Krise.
Der Autor schreibt in diesem Zusammenhang weiter: „Keynes verdanken wir die Einsicht, dass selbst reibungslos funktionierende Märkte unter Umständen nicht zu einem eindeutigen Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung streben.“ Es stellt sich die Frage: Wie begründet sich diese Aussage? Ist sie die Wiedergabe dessen, was gemeinhin als Konsens gilt? Oder entstammt sie eigenen Beobachtungen?
Die großen Krisen – Weltwirtschaftskrise 1929, Asien-Krise 1997, Russlandkrise 1998; Platzen des „New Economy-Hypes“ 2000/2001, Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009, Weltwirtschaftskrise 2020 – sind allesamt das Ergebnis staatlichen Eingreifens in das System der freien Märkte. Sie sind das Ergebnis des staatlichen Interventionismus – der Wirtschaftspolitik, der heute die Mehrheit der Ökonomen anhängt. Die vergangenen Krisen bieten keine Evidenz, dass freie Märkte nicht „zu einem eindeutigen Gleichgewicht“ streben.
Krisen und Rezessionen nach dem künstlichen Boom sind auch gar nicht vermeidbar, sondern höchstens unter Kosten einer noch schwereren Krise temporär verschiebbar. Rezessionen sind die Phase der Gesundung einer im Boom verzerrten Wirtschaftsstruktur, die im Sinne der Konsumenten so schnell als möglich korrigiert werden sollte.
Täuschung über die wahren Kosten
Der Autor vertritt die Auffassung, die Zentralbanken hätten in der Coronavirus-Krise die Volkswirtschaften „gerettet“. Doch was ist wirklich passiert? Die Regierungen haben einen Lockdown diktiert. Dadurch hat es erst einen derart gewaltigen Produktionseinbruch und Massenarbeitslosigkeit gegeben. Um die wahren Kosten dieser Politik vor der Öffentlichkeit zu verbergen, drucken die Zentralbanken neues Geld für den Staat, und der zahlt es als Transfer an die in Bedrängnis gebrachten Arbeitnehmer und Unternehmen aus.
Die Regierungen geben sich damit den Anschein eines zweifachen Retters: Sie retten die Menschen vor den Folgen des Coronavirus, und sie retten die von ihnen Geschädigten mit neu gedrucktem Geld. Die Rechnung haben die Geschädigten selbst zu tragen: Mit Kaufkraftverlust ihres Geldes. Wenn Vasséi schreibt, es obliege „der Geldpolitik, Unsicherheiten zu minimieren und so die Erwartungen der Marktteilnehmer zu stabilisieren“, dann ist das bestenfalls ein eleganter Versuch, die Leser über die wahren Konsequenzen der Geldpolitik im Unklaren zu lassen.
Auf die Quellen kommt es an
Wenn es gilt, Hayeks Beurteilung mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse abschätzen zu wollen, sind seine späten Hauptwerke wie „Die Verfassung der Freiheit“ (1960) und „Recht, Gesetz und Freiheit“ (1973, 1976 und 1979) vielleicht weniger geeignet als seine frühen Schriften, allen voran sein Weltbestseller „Der Weg zur Knechtschaft“ (1944). Darin hat Hayek klar erfasst, wohin die Reise geht, wenn der Staat zusehends die Kontrolle über Wirtschaft und Gesellschaft gewinnt: in die Tyrannei, in den Totalitarismus. Aber auch „The Intellectuals and Socialism“ (1949) würde zu den aktuellen Problemstellungen erstaunlich Kritisches zutage befördern.
Auch 1960 hatte Hayek noch die zentrale Gefahr für Freiheit und Wohlstand klar vor Augen: das Abrutschen der Gesellschaften in den Sozialismus. Er schrieb, dass
„der Sozialismus als bewußt anzustrebendes Ziel zwar allgemein aufgegeben worden ist, es aber keineswegs sicher ist, daß wir ihn nicht doch errichten werden, wenn auch unbeabsichtigt. Die Neuerer, die sich auf die Methoden beschränken, die ihnen jeweils für ihre besonderen Zwecke am wirksamsten scheinen, und nicht auf das achten, was zur Erhaltung eines wirksamen Marktmechanismus notwendig ist, werden leicht dazu geführt, immer mehr zentrale Lenkung der wirtschaftlichen Entscheidungen auszuüben (auch wenn Privateigentum dem Namen nach erhalten bleiben mag), bis wir gerade das System der zentralen Planung bekommen, dessen Errichtung heute wenige bewußt wünschen. Außerdem finden viele der alten Sozialisten, daß wir schon so weit auf den Zuteilungsstaat zugetrieben sind, daß es jetzt viel leichter scheint, in dieser Richtung weiter zu gehen, als auf die etwa in Mißkredit geratene Verstaatlichung der Produktionsmittel zu drängen. Sie scheinen erkannt zu haben, daß sie mit einer verstärkten staatlichen Beherrschung der nominell privat gebliebenen Industrie jene Umverteilung der Einkommen, die das eigentliche Ziel der sensationelleren Enteignungspolitik gewesen war, leichter erreichen können.“
Dass Hayek angesichts der ausgeuferten Machtstellung des heutigen Staates in Wirtschaft und Gesellschaft den Staat nicht mit noch mehr Macht betrauen würde, erscheint uns wahrscheinlicher als das Unbedenklichkeitsattest, das Vasséi Hayek abzuringen versucht. Hayek hätte ganz bestimmt auch in Sachen Geldpolitik heftige Kritik geäußert, und das sieht Vasséi ganz richtig. Denn schließlich war Hayek der Auffassung, das staatliche Geldmonopol sei ein großes gesellschaftliches Übel und müsse abgeschafft werden – und das hat er in seinem Buch „The Denationalization of Money“ (1976) ausführlich rationalisiert. Nein, das Narrativ des Neo-Keynesianismus, das Vasséi mit Blick auf die Maßnahmen des Staates und seiner Zentralbank in Zeiten der Pandemie in der F.A.Z. entfaltet, kann aus unserer Sicht in keinem Punkt überzeugen, und wir können auch nicht nachvollziehen, wie sich Hayek als Kronzeuge von den Neo-Keynesianern vereinnahmen ließe.
Tags: Aktuelles,Featured,Geld,newsletter,Politik,Rubriken,Staat,Wirtschaft